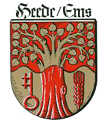Eine Plauderei von Hermann Abels.
Die Tabakpflanze (Nicotiana Tabacus) wurde 1492 von den seefahrenden Spaniern auf der Antilleninsel Haiti aufgefunden, wo von den Eingeborenen deren Blätter getrocknet und als Reizmittel aus einfachen Holzröhren geraucht wurden. Es hat aber über anderthalb Jahrhunderte gedauert, bis in Europa die „Unsitte des Tabaktrinkens“, wie man anfangs sich ausdrückte, trotz der längere Zeit darauf gesetzten behördlichen, zum Teile schweren Strafen, sich verallgemeinerte.
Zuerst verbreitete sich das Tabakrauchen, wie erklärlich, unter den Seeleuten der die Ozeane befahrenden Völkerschaften und dort namentlich in den Küstenländern. In unserer Gegend dürfte das Tabakrauchen von den Niederlanden her sich allmählich verbreitet haben, wofür namentlich auch die Tatsache spricht, daß in Nordwestdeutschland bis in das 18. Jahrhundert zurück und tief in das 19. Jahrhundert hinein die weiße, lang= oder kurzstielige einfache Tonpfeife bis in die vornehmen Schichten hinein umsomehr das Gebiet behauptete, je näher die Niederlande an deren Heimat lagen.
Noch ist es kaum ein Jahrhundert her, daß bei besonderen dörflichen Festen (von altersher „Biere“ genannt) die jungen Mädchen eine Art Vorfeier im „Piepenmaken“ hatten, indem sie am Abend zusammenkamen, um die beim Feste von den Männern zu benutzenden langen Tonpfeifen mit bunten Papierschnitzeln und Bändern zu schmücken. Auf jeder größeren Haushebung ging der abendlichen Feier ein solches „Piepenmaken“ voran, an das ich mich aus meinen Kinderjahren noch lebhaft erinnere, wenngleich es damals meist nur noch einen abendlichen oder auch nachmittägigen „Kaffeeklatsch“ der nachbarlichen Frauen und erwachsenen Töchter darstellte.
In Holland hatte der vornehme reiche Mijnheer noch in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts in seiner „Kamer“ ein manchmal künstlerisch ausgeführtes hölzernes Gestell, auf dem ein Dutzend oder noch mehr gebrauchter und ungebrauchter langstieliger Tonpfeifen thronte. Wenn Mijnheer eine von diesen ausgeraucht hatte, zog er die Klingel. Dann trat der Bediente ein und erhielt den Befehl: „Jan, schoon de pijp!“ und Jan erwiderte zum Beweise, daß er ihn verstanden hatte, stets: „Schoon de pijp,M´neer!“ („reinige die Pfeife“)
Die Holländer waren seit Jahrhunderten in der Herstellung von einfachen bis zu hochkünstlerischen Tonwaren aller Art weithin bekannte Meister – man braucht nur an ihre bemalten Schauschüsseln in Gestellen an der Wand, oder die „Esterkes“ an der Herdwand, wie überhaupt die Delfter Porzellanwaren zu erinnern. Wenn auch keine anderen Anzeichen dafür sprächen, könnte man schon hieraus mutmaßen, daß sie die Erfinder der tönernen Tabakpfeife seien. Irgendwelche schriftlichen Angaben, die das bestätigen oder darauf hindeuten, sucht man indes in der einschlägigen älteren und neueren Literatur vergebens, höchstens wird die Vermutung ausgesprochen, daß die Tonpfeifen die Vorgängerinnen der hölzernen Tabakspfeife mit innerer Blechhülse gewesen seien.
Eine bisher meines Wissens noch nirgends erörterte Tatsache kann jedoch ein gewisses Licht auf die Herkunft der primitiven aber eine lange Reihe von Jahrzehnten verbreitetsten Tonpfeife werfen. Es ist nämlich unbedingt sicher, daß die irdene Tonpfeife genau in der Form, wie sie noch jetzt besteht und auch als Spielzeug für Knaben zur Erzeugung von Seifenblasen gebraucht wird, weit älter ist als das europäische Tabakrauchen und schon mindestens im späteren Mittelalter Verwendung fand.
In der zweiten Hälfte der achtziger Jahre, als ich in Aachen wohnte und als Freund der Volkskunde in dieser alten Stadt Karls d. Gr. besonders reiche Gelegenheit zur Weiterbildung auf deren Gebiete fand, wurde beim Bau des neuen Fernsprechamts im östlich vom Hauptpostamte am Kapuzinergraben gelegenen Garten des Hauptpostamtes eine alte Mauer teilweise abgebrochen, welche diesen von der Borngasse trennte. In letzterer befanden sich meine damaligen Redaktionsräume, daher kam ich täglich mehrmals durch diese Gasse und achtete auch auf Kennzeichen für die Feststellung des Alters der Mauer, die nur durch die verhältnismäßig breite Gartenfläche von der Ostgrenze der karolingischen Altstadt und deren ehemaligen Befestigung getrennt war. Die mit dem Abbruch beschäftigten Arbeiter und deren Aufseher hatte ich gebeten, mich aufmerksam zu machen, wenn sich etwas Besonderes zeigen sollte. In einer historischen Stadt wie Aachen kann man ja bei ähnlichen Anlässen auf Schritt und Tritt Ueberraschungen erwarten.
Eines Tages, als ich zur Mittagspause gehen wollte, rief der Aufseher mich mit lachendem Gesichte heran und sagte, man habe soeben mitten im alten – etwa zweidrittel bis dreiviertel Meter starken – Kalk=Bruchstein=Mauerwerk Tabakpfeifen gefunden! Ich dachte nicht anders, als daß man mich zum Besten halten wollte, schüttelte den Kopf, ging aber mit zu der angeblichen Fundstelle. Und in der Tat: in einer kleinen Höhlung des Mauerwerks fanden sich vier gebrannte Tonpfeifen, fast ganz genau wie sie noch jetzt sind, mit Stielen von etwa 14 – 18 cm Länge. Zwei lagen fast ganz unversehrt und wie neu in der mörtelfreien Höhlung, eine dritte war mehrfach gebrochen und eine vierte steckte ebenfalls zerbrochen, mit dem oberen Teile des Stieles in dem alten festen Kalkmörtel – ein sicherer Beweis, daß die Gegenstände, aus welcher Ursache auch immer, bei der Errichtung der Mauer in diese gelegt waren. Es gelang durch behutsames Vorgehen, alle vier irdenen Pfeifchen, die vierte mit einem Stück des umfassenden Mörtels, herauszunehmen.
Bei näherer Besichtigung zuhause ließ sich bei zweien mit Sicherheit, bei den beiden anderen nur zweifelhaft feststellen, daß im Innern der „Köpfe“ irgendwelche Gegenstände verbrannt sein mußten. Um dies näher zu klären, legte ich in den nächsten Tagen die Sachen einem befreundeten Chemiker vor, der bei der Untersuchung feststellte, daß die Brandspuren mit größter Wahrscheinlichkeit von organischen (pflanzlichen) Stoffen herrührten. Tabak sei es indes wohl kaum gewesen. Nunmehr nahm ich den ganzen Fund in die nächste Vorstandssitzung des „Vereins für Kunde der Aachener Vorzeit“ mit, wo man beschloß, zunächst mit Sicherheit festzustellen, aus welcher Zeit die erwähnte Mauer stamme. Die geschichtliche Nachforschung ergab, daß sie in die Zeit von 1300 – 1350 fallen müsse, also bestimmt bedeutend älter sei als das Bekanntwerden der Tabakpflanze in Europa. Welchem Zwecke die Gegenstände gedient haben könnten, wußte niemand anzugeben. Der Fund blieb zunächst in der Verwahrung des genannten Vereins; da ich nicht lange nachher Aachen verließ, bin ich über seinen Verbleib nicht weiter unterrichtet.
Nachdem ich ihn längst vergessen hatte, las ich während des Weltkrieges in einer mir nicht mehr in Erinnerung stehenden Zeitung Norddeutschlands eine kurze Ortsnotiz über einen ganz ähnlichen Altertumsfund; aber damals hatte man, zumal als Redakteur, mit anderen Sachen Kopf und Hände zu voll, um sich um solche Funde kümmern zu können. Den Zeitungsausschnitt hatte ich mir indes verwahrt, kann ihn aber jetzt in den Mappen nicht mehr finden.
Immerhin habe ich die Sache mir mehrfach durch den Kopf gehen lassen und bin zu einer Vermutung gekommen, die vielleicht nicht ganz unwahrscheinlich ist. Daß es im späteren Mittelalter bereits Tonpfeifen, ganz ähnlich den neuzeitlichen und zur Erzeugung von Rauch gab, ist im Obigen sicher erwiesen. Aber zu welchem Zwecke? Es liegt nichts näher, als an die Imkerei zu denken, bei der Pfeifenrauch noch allgemein eine Rolle spielt, nämlich um im Bienenkorb die Tierchen zurückzutreiben und bei dem Schwärmen zu verhüten, daß sie sich durch ihre Stacheln an dem Bienenvater vergreifen. Dafür eignet sich der ätzende Rauch des Tabak, aber auch der ähnlich wirkende Qualm der trockenen Blätter mancher sonstigen Pflanzen mit scharfem Geruche. Vorrichtungen zur Erzeugung derartigen Rauches wird man bei der in alter Zeit weit wichtigeren und verbreiteteren Bienenzucht wohl sicher, wahrscheinlich sogar in verschiedenen Methoden, gekannt haben, und da liegt kaum etwas näher, als das man bei dem Aufkommen des „Tabaktrinkens“, wie man das Tabakrauchen anfangs nannte, die Bienenpfeifen, besonders in den Niederlanden und deren Nachbarschaft, anfangs dafür benutzte, wie man sie in der Imkerei seit Jahrhunderten zu verwenden gewohnt war.
Daß man später den Stiel bedeutend verlängerte, lag sehr nahe schon der Bequemlichkeit halber und sodann wegen der Erfahrung, daß der sich abkühlende Rauch – wie wir Pfeifenraucher ja alle wissen – wesentlich milder und angenehmer ist. Die lange Tonpfeife läßt sich indes im wesentlichen nur verwenden, wenn die Hände keine Tätigkeit zu leisten haben, machte also die kurzstielige für den Raucher nicht entbehrlich, und nach der Erfindung des Porzellan= oder Holz=Pfeifenkopfes schuf man anstelle des tönernen Stieles einen hölzernen mit einer Mundspitze aus Horn, anfangs nach dem Muster der kurzen Tonpfeife in gerader Form = die „Nutzpfeife“, wie sie noch jetzt in Uebung ist. Auch diese wird, wie ihr Name verrät, dem seefahrenden Holland, dem Urlande des westeuropäischen Pfeifenrauchens, ihren Ursprung verdanken. „Mots“ ist nämlich im Holländischen unser deutsches „Stutz“ = Verkürzung, z. B. des Schwanzes oder Ohres beim Hunde; motse bezeichnet in Overijsel (und auch im angrenzenden Westfälischen mutse) eine Hühnerart ohne Schwanz usw. Also eine verkürzte, „gestutzte“ Pfeife.
Nun bitte ich namentlich die weiblichen Leser um gütige Entschuldigung wegen des Umfanges dieser Ausführungen: sie sind nämlich bei der – langen Pfeife geschrieben.
Quelle: Mein Emsland 8. Jahrgang 1932 Beilage zur Ems-Zeitung
Druck und Verlag: Buchdruckerei der Ems-Zeitung L. Rosell, Papenburg