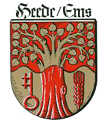Von Hermann Abels.
Langsam und allmählich kleidet sich unsere gemeine Heide (Calluna vulgaris) in ihr fleischrotes Festgewand, unmerklich entwickeln und öffnen sich die reichlich nadelkopfgroßen Einzelblütchen der Trauben, die zu tausenden aneinandergereiht eine einzige Blüte des Stammes und zu hunderttausenden von Stämmen vereinigt eine lückenlose blühende Flur zu bilden scheinen. Es ist jetzt nicht so einfach mehr, solche blühenden Heidefelder zu finden und zu schauen. Die Heide ist ein Kind der Einsamkeit, aber sie selber ist in hohem Maße ihresgleichen gesellig. Sie liebt große Flächen, die von der menschlichen Kultur frei sind, die Nähe bebauten Landes haßt sie dermaßen, daß sie sich allmählich davon zurückzieht und zunächst großen Gräsern Platz macht oder den nackten Boden bei ihrem Scheiden zurückläßt.
Nun rückt aber durch die Arbeit der Menschenhand und der von ihr gelenkten Maschinen der kultivierte Boden insbesondere mit Hilfe der künstlichen Düngemittel unaufhaltsam weiter; wo vor wenigen Jahrzehnten noch Ödland und Moor sich weithin dehnte, auf dem höchstens genügsame Heidschnucken ihre Nahrung suchten und im Spätherbst der Jäger den grauwolligen Hasen nachstellte, werden die Wasserläufe geregelt, Wege gebahnt, Äcker und Wiesen angelegt, erheben sich Kolonistenhäuser – mit der Heide ist es vorbei, sie fühlt selbst, daß ihre Zeit dahin ist und verschwindet in wenig Jahren, fast unbemerkt, auch auf den kleinen Flächen, die zwischen den in Kultur genommenen liegen geblieben sind. Sie will Alleinbeherrscherin ihres Gebietes sein oder überhaupt nicht sein.
Noch haben wir ausgedehnte Heidegebiete; aber sie sind mehr oder weniger echte Heidebezirke nur dort, wohin sich der Sommergast aus der Stadt nicht auf die Dauer begibt, weil er die von ihm beanspruchte Bequemlichkeit für Wohnung und Kost, Gesellschaft und Unterhaltung nicht findet. Die Heide in ihrer ganz eigenartigen Schönheit offenbart sich nur auf sehenswerten Fluren, wo bloß des Himmels Sonnenschein über ihr ruht, die Lerche ihr das Morgenlied singt, blaue, braune, graue Schmetterlinge über sie herhuschen und gaukeln, glänzende Libellen sie umtändeln, die ungeschlachte Hummel mit ihr in verträumtem Gesumm Zwiesprache hält, der Hase unter ihren dünnen Zweigen sein Lager scharrt.
Erst im Juni treibt sie ihr neues mattes Grün, langsam und bedächtig, das sich alsbald mehr und mehr dem verschwommenen Braun am alten Stämmchen angleicht. Im Juli entwickeln sich die kaum sichtbaren Blütenknospen, und erst, wenn die Sicheln in den Kornfeldern zu klingen begonnen haben, fühlt sie in sich ihr volles Leben. Aber auch hiermit hat es keine Eile; noch Wochen verfließen, bis die Heide ihr Brautkleid fertig hat; zumeist erst zu Mitte August reiht sich Stenglein an Stenglein von unten bis oben mit Blütchen an Blütchen besetzt. Pflanze an Pflanze, soweit das Auge späht: ein schimmerndes Gewand von wunderbarem Schmelz überflossen. Nun ist die Hochzeitsfeier der Heide gekommen: Insekten der verschiedensten Art sind ihre Gäste, vor allem aber die fleißigen Bienen, die in ungezählten Scharen allüberall Blütchen für Blütchen getreulich besuchen und begrüßen. Dann summt es über der ganzen rötlich glänzenden Fläche, die Töne verschwimmen ineinander zu einer eigenartigen Harmonie – eigenartig deshalb, weil sie dem Eintönigen, der Einsamkeitsstille des Heidefeldes vollkommen in ihrem Grundtone entspricht und dennoch für den geistig darauf gestimmten, mit Ohr und Seele still lauschenden einsamen Wanderer etwas endlos Wechselvolles hat.
An solchen Tagen bietet die Heide einen Genuß, wie er nirgend anderswo in ähnlicher Art zu finden ist. Aber immer nur für den einzelnen oder für die wenigen Wanderer, die dann die Gemeinsamkeit aufzulösen und sich in Gesellschaft ganz als Einzelne zu fühlen verstehen. Einen großen und erhebenden Genuß hat die blühende Heide auch für die Gemeinsamkeit der Besucher bereit, aber nur für deren Auge wegen der in ihrer Schlichtheit und großstimmigen Herbheit unvergleichlich bezaubernden Farben. Den rechten Genuß für das Ohr und die Seele kann die Heide nur an einem Sonnentag des Frühherbstes in ihrer Einsamkeit dem Einsamen gewähren, der dann ganz für sich zu sein versteht: dann schweben, wenn er fern am Horizont die Wolkenschäfchen wandeln sieht, gütige Geister über dem endlosen Blütengefilde, denen die Sandheuschrecken entgegenzirpen und die Bienen ihr tiefes Verständnis musikalisch kundgeben.
Schwermütig pflegt man den Charakter der Heide zu nennen, d. h. der weiten Heidefelder, die wir hier im Auge und vor dem Auge haben. Das ist nicht unrichtig, wenigstens auf den ersten Blick nicht. Aber wenn man mit genauer Seele tiefer in das Wesen der Heidelandschaft zu dringen sucht, wird man, meine ich, diesen wohl zutreffender als leidenschaftslos bezeichnen dürfen. Ruhig, unbeirrt von der ganzen Umgebung, fängt die Heide im Frühling an, sich zu entwickeln. Mögen früh die Birken sich in helles Laub kleiden und ihre langen Blütenkätzchen holdselig erfreut herabhängen lassen, mag der Vogelbeerbaum seine breiten anspruchsvollen Dolden stolz zur Schau stellen, es bekümmert sie nicht, sie wird nicht eifersüchtig, sie erwartet voller Ruhe ihre Zeit, und wenn alles um sie her bereits in den Abschnitt des Reisens getreten ist, wie er nach dem ewigen Kreislaufe der Natur das Herannahen des Absterbens bedeutet, dann fühlt sich die Heide stark genug, in kerniger Vollkraft den Triumph ihres Daseins zu erweisen.
Sie blüht, aber nicht einige Tage, sondern einen Monat und darüber hinaus in immer neuen Farbenschattierungen, fast bis zum Erscheinen des ersten Schnees, und langsam, fast unbemerkbar, geht auch sie zufrieden und gleichsam im Vollbewußtsein der erfüllten Pflicht mit ihren falb gewordenen, aber immer noch festhaftenden Blüten im Arme in den traumlosen, festen Schlaf, um erst, wenn das neue Tagesgestirn ihre Wurzeln mit sanfter Wärme durchdrungen hat, die neue Jahresarbeit ernst und zielbewußt zu beginnen.
Quelle: Mein Emsland Jahrgang 1931 Beilage zur Ems-Zeitung
Verlag: Buchdruckerei der Ems-Zeitung L. Rosell, Papenburg